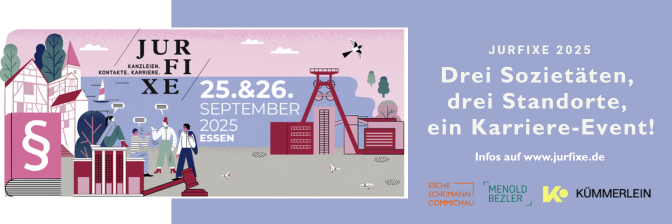Was ist der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?
Prüfungsschema des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter:
- Schuldverhältnis zwischen anderen Personen
- Leistungsnähe des Dritten
- Einbeziehungsinteresse
- Erkennbarkeit
- Schutzbedürftigkeit des Dritten
Merkwort: SchLEESch (Jeweils die Anfangsbuchstaben der Prüfungspunkte)
Häufige Klausurschwerpunkte:

Flexibel & ideale Vorbereitung auf das 2. ExamenWissMit · Hamburg (remote möglich)Stellenanzeige ansehen
Tipp: Als Grundlage für die Klausur- und Examensvorbereitung können wir die Karteikarten von Examen mit Sandro empfehlen. Die Karteikarten sind inhaltlich sehr gut, ihr spart euch hunderte Stunden Arbeit und könnt direkt mit dem Lernen anfangen. Mit dem Code "JurInsight10" spart Ihr 10 % beim Kauf. (Unbezahlte Werbung)
Was ist der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?
Bei Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter handelt es sich um ein Rechtsinstitut, mit dem eine fremde Person in den Schutzbereich eines Schuldverhältnisses einbezogen wird. Hintergrund des Vertrags mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter ist, dass die Haftung innerhalb von Schuldverhältnissen deutlich strenger ist als im Deliktsrecht.
- Vermögensschäden: Etwa werden Vermögensschäden vom Deliktsrecht nicht geschützt, innerhalb von Schuldverhältnissen hingegen schon.
- Beweislastumkehr: Die Beweislastumkehr nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB gilt nicht im Deliktsrecht.
- Haftung für Dritte: Die Haftung für Dritte nach § 278 BGB ist deutlich strenger als nach § 831 BGB, indem bei § 831 BGB etwa die Exklupation möglich ist.
In problematischen Fällen ist somit der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter eine Möglichkeit, die Nachteile des Deliktsrechts zu umgehen.
Es ist umstritten, ob der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter aus § 311 BGB, § 328 BGB oder aus einer ergänzenden Vertragsauslegung hergeleitet wird. Vor dem Hintergrund, dass alle zu den gleichen Prüfungspunkten kommen, ist dieser Streit für das Ergebnis irrelevant.
Beispiel: Das klassische Beispiel für den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist der „Salatblattfall“. Ein Kind geht mit der Mutter einkaufen und rutscht im Laden auf einem Salatblatt aus. Aufgrund des Kaufinteresses der Mutter besteht zwischen der Mutter und dem Ladeninhaber ein vorvertragliches Schuldverhältnis. In dieses Schuldverhältnis wird das Kind über den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter einbezogen, sodass es einen vertraglichen Schadensersatzanspruch gegen den Ladeninhaber auf Schmerzensgeld hat.
1. Schuldverhältnis zwischen anderen Personen
Zuerst muss zwischen zwei Personen ein Schuldverhältnis bestehen. Dies kann etwa ein vertragliches oder auch ein vorvertragliches Schuldverhältnis sein. Im Rahmen dieses Prüfungspunktes können viele BGB-AT-Probleme in eine Klausur / Hausarbeit eingebaut werden.
2. Leistungsnähe des Dritten
Dazu muss der Dritte mit der Hauptleistung in Berührung kommen bzw. Schutzpflichtverletzungen ebenso ausgesetzt sein wie der Gläubiger selbst. An diesem Prüfungspunkt muss also genau geschaut werden, ob das Risiko des Dritten vergleichbar ist.
Im Beispiel ist dies etwa der Fall, da das Kind genau gleich gefährdet ist wie die Mutter.
3. Einbeziehungsinteresse des Gläubigers an der Einbeziehung des Dritten
Dazu wird der Dritte nur in den Schutzbereich eines Schuldverhältnisses aufgenommen, wenn eine der Vertragsparteien ein Interesse daran hat. Die Formel des BGH hierfür ist sehr weit, ausreichend ist jedes schutzwürdige Einbeziehungsinteresse.
Beispiele zum Prüfungspunkt des Einbeziehungsinteresses:
- Familiäre Beziehung: Eltern haben etwa beim Einkaufen ein Interesse daran, dass ihre Kinder in das Schuldverhältnis einbezogen werden, da die Eltern für das Wohlergehen der Kinder verantwortlich sind.
- Arbeitnehmer: Ein Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Angestellten, sodass auch ein Einbeziehungsinteresse besteht.
- Rechtsanwalt: Der Mandant eines Anwaltes hingegen hat in der Regel kein Interesse daran, den für ihn handelnden gesetzlichen Vertreter in den Anwaltsvertrag einzubeziehen.
4. Erkennbarkeit
Auch muss der Schuldner erkennen können, wer in den Schutzbereich des Vertrages einbezogen wird. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Name oder die Anzahl der Personen konkret bekannt ist. Allerdings muss der Schuldner in der Lage sein, das Risiko überblicken zu können.
5. Schutzbedürftigkeit des Dritten
Auch muss die Dritte Person schutzbedürftig sein. An der Schutzbedürftigkeit fehlt es, wenn der Dritte einen gleichwertigen Anspruch gegen den Gläubiger hat. Deliktische Schadensersatzansprüche (z.B. aus § 823 BGB) sind nicht gleichwertig. Aufgrund der unterschiedlichen Verteilung der Beweislast und der eingeschränkten Haftung für Verrichtungsgehilfen sind Ansprüche aus Deliktsrecht deutlich unattraktiver.
6. Rechtsfolgen
Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, besteht ein Schuldverhältnis zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner ein eigenes Schuldverhältnis. Liegt eine Pflichtverletzung vor, können entsprechend vertragliche Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass § 334 BGB analog angewendet wird, sodass auch Einwendungen die gegen den Gläubiger bestehen oder das Mitverschulden des Gläubigers anspruchsmindernd geltend gemacht werden können.