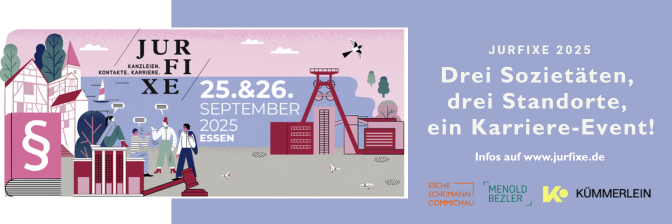§ 7 StVG: Prüfungsschema
Prüfungsschema § 7 StVG:
- Rechtsgutsverletzung
- Betrieb eines Kfz
- Haltereigenschaft des Anspruchsgegners
- Zurechnung (Äquivalente Kausalität & Betriebsgefahr)
- Kein Ausschluss der Ersatzpflicht
- Rechtsfolge (insb. § 17 StVG)
Häufige Klausurschwerpunkte:

Flexibel & ideale Vorbereitung auf das 2. ExamenWissMit · Hamburg (remote möglich)Stellenanzeige ansehen
Tipp: Als Grundlage für die Klausur- und Examensvorbereitung können wir die Karteikarten von Examen mit Sandro empfehlen. Die Karteikarten sind inhaltlich sehr gut, ihr spart euch hunderte Stunden Arbeit und könnt direkt mit dem Lernen anfangen. Mit dem Code "JurInsight10" spart Ihr 10 % beim Kauf. (Unbezahlte Werbung)
1. Rechtsgutsverletzung
§ 7 Abs. 1 StVG setzt voraus, dass eine dieser drei Rechtsgüter verletzt ist:
- Tod eines Menschen
- Körper- oder Gesundheitsverletzung
- Sachbeschädigung
Entsprechend ist der Anwendungsbereich von § 7 StVG recht eng gefasst. Hintergrund davon ist, dass § 7 Abs. 1 StVG ein Anspruch aus Gefährdungshaftung ist, da für den Schadensersatzanspruch kein Verschulden vorliegen muss. Um zu verhindern, dass der Schadensersatzanspruch zu weit greift, werden nur die drei genannten Rechtsgüter geschützt.
2. Betrieb eines Kfz
Die Definition für Kfz steht in § 1 Abs. 2 StVG.
- Kraftfahrzeuge sind Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.
Ein Kfz ist nach h.M. so lange in Betrieb, wie das Kfz in Verkehrsbeeinflussender Art und Weise am Straßenverkehr teilnimmt. Wobei die Definition recht weit ausgelegt wird, so ist sogar ein am Straßenrand parkendes Auto „bei Betrieb“. (Verkehrstechnische Auffassung)
Eine heute nicht mehr vertretbare m.M. nimmt, an dass sich ein Fahrzeug solange in Betrieb befindet, wieder Motor eingeschaltet ist und das KFZ sich infolgedessen bewegt (Maschinentechnische Auffassung).
Folgende Beispiele dienen als Orientierungshilfe:
- Bei Betrieb (+): Das Be- und Entladen eines Kfz gehört zum Betrieb. Ein wegen technischer Defekte liegen gebliebenes Kfz ist so lange in Betrieb, bis es von der Straße entfernt wird. Auch wenn ein Kfz ein Fahrzeugteil verliert, ist der Verlust dem Betrieb des Kfz zuzurechnen.
- Bei Betrieb (-): Ein Kfz, welches abgeschleppt wird und für das Abschleppen vollständig auf ein Lkw geladen wird, ist nicht mehr in Betrieb. Wenn ein Kfz außerhalb des Straßenverkehrs ordnungsgemäß abgestellt wird, befindet es sich grds. nichtmehr in Betrieb.
Insgesamt ist die Rechtsprechung zu dem Prüfungspunkt bei Betrieb uneinheitlich und die meisten Klausuren und Hausarbeiten basieren auf aktuellen Entscheidungen, sodass es sinnvoll ist, dieaktuelle Rechtsprechung im Blick zu haben.
3. Haltereigenschaft des Anspruchsgegners
Halter eine Kfz ist, wer das Kfz für eigene Rechnung im Gebrauch hat und die zum Gebrauch erforderliche Verfügungsgewalt über das Kfz hat. Entsprechend kommt es nicht auf die Stellung als Eigentümer des Autos an, das Eigentum an dem Kfz dient wenn überhaupt als Indiz.
Diese Besonderheiten sollte man bezüglich der Haltereigenschaft kennen:
- Leasing: Beim Leasing ist der Leasingnehmer in der Regel Halter des Kfz. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Kfz für eine längere Zeit geleast wurde.
- Firmenwagen: Wenn derArbeitgeber über den Einsatz des Kfz bestimmen kann, etwa bei einem Auto,welches ein Angestellter nur während der Arbeitszeit verwendet, dann ist derArbeitgeber Halter des Kfz.
- Dienstwagen: Bei Dienstwagen, also Kfz, die dem Arbeitnehmer auch zur privaten Verwendung zur Verfügung stehen, dann ist der Arbeitnehmer Halter des Kfz.
4. Zurechnung
Für den Schadensersatzanspruch aus § 7 Abs. 1 StVG ist es erforderlich, dass ein Zurechnungszusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem Betrieb besteht.
- Äquivalente Kausalität: Die äquivalente Kausalität liegt vor, wenn der Betrieb des Kfz nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass die Rechtsgutsverletzung entfällt. Dabei handelt es sich um die Conditio-sine-qua-non-Formel, die Juristen bereits aus dem Strafrecht kennen.
- Adäquate Kausalität: Die adäquate Kausalität, also die Vorhersehbarkeit der Rechtsgutsverletzung, ist bei der Gefährdungshaftung aus § 7 StVG nicht erforderlich. Hintergrund ist, dass § 7 Abs. 1 StVG gerade auch unvorhersehbare Rechtsgutsverletzungen erfassen soll.
- Schutzzweck der Norm: Auch muss der Schutzzweck der Norm einschlägig sein. Dies setzt voraus, dass sich in der Rechtsgutsverletzung die Betriebsgefahr des Kfz realisiert haben muss. Dies ist der Fall, wenn die Rechtsgutsverletzung in einem nahen örtlichen und zeitlichen Kausalzusammenhang mit dem Betriebsvorgang steht. Ein einer Realisierung der Betriebsgefahr fehlt es, wenn sich nicht die Betriebsgefahr des Autos verwirklicht, sondern die Verletzung aus einem anderen, von Dritten oder dem Geschädigten geschaffenen Gefahrenkreis herrührt. Ein Beispiel ist etwa, wenn ein Unfall zu einer Panik in einem Schweinestall führt, wodurch Schweine sterben, dabei realisiert sich keine Gefahr des Kfz.
5. Kein Ausschluss der Ersatzpflicht
Auch darf die Ersatzpflicht nicht ausgeschlossen sein.
Die Ersatzpflicht wird in den folgenden Fällen ausgeschlossen:
- § 7 Abs. 2 StVG: Wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird, ist die Ersatzpflicht ausgeschlossen. Höhere Gewalt liegt bei betriebsfremden, von außen durch Naturkräfte oder durch Handlungen Dritter herbeigeführten Ereignissen vor, die nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar sind und nicht mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch äußerste Sorgfalt verhindert werden können und auch nicht wegen ihrer Häufigkeit in Kauf zu nehmen sind.
- § 7 Abs. 3 StVG: Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn das Kfz ohne Wissen und Willen des Halters benutzt wird und den Halter kein Verschulden trifft bezüglich der ungewollten Benutzung des Kfz.
- § 8 StVG: Dadurch wird etwa die Haftung ausgeschlossen, wenn das Kfz weniger als 20 km/h fahren kann.
- § 15 StVG: Der Anspruch verwirkt innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis.
6. Rechtsfolge
Liegen die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 StVG vor, ergibt sich die Höhe und die Art und Weise des Schadensersatzes aus den §§ 249ff. BGB.
Wichtig ist die § 17 StVG und § 9 StVG zu berücksichtigen. § 17 StVG dient der Abwägung der Verschuldensanteile bei einem Unfall, an dem mehrere Kfz beteiligt waren und geht inssoweit § 9 StVG iVm § 254 BGB analog vor. § 9 regelt das Mitverschulden von Geschädigten die nicht Halter oder hatungspflichtiger Fahrzeugführer i.S.v. § 18 Abs. 1 StVG sind.
- Im Prinzip sind drei Konstellationen zu unterscheiden:
- Bei einem Unfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen ohne Verletzung von Rechtsgütern Dritter gilt: Die Haftungsquote der Halter und hatungspflichtiger Fahrzeugführer i.S.v. § 18 Abs. 1 StVG bestimmt sich nach § 17 Abs. 2, 1 StVG.
- Wenn es zu einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug und einem Verletzten Dritten (Fußgänger, Radfahrer oder Insasse) gilt: Das Mitverschulden des Dritten bestimmt sich nach § 9 i.V.m. § 254 BGB analog.
- Bei einem Unfall mit mindestens zwei Kraftfahrzeugen bei dem ein Fußgänger, Radfahrer oder Insasse verletzt wird, gilt folgendes: Die beiden Kfz-Halter haften dem verletzten Dritten gem. § 7 Abs. 1 voll als Gesamtschuldner. Im Innenverhältnis zwischen den Haltern bestimmt § 17 Abs. 1 die Haftungsquote. Untereinander bestimmt sich die Haftungsquote nach Beim Anspruch des Dritten ist nur dessen Mitverschulden nach § 9 StVG i.V.m. 254 BGB analog zu prüfen.
- Inzidentprüfung: Bei § 17 StVG ist innerhalb der Rechtsfolge vorrangig zu prüfen, ob der Geschädigte selbst nach § 7 StVG haftet. Entsprechend sind die zuvor genannten Prüfungspunkte alle vollständig zu prüfen.
- Kein § 17 Abs. 3 StVG: Die Verpflichtung zum Ersatz nach § 17 Abs. 1, 2 StVG ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein für den Kraftfahrzeugführer unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Kraftfahrzeugs noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen beruht. Dieser Prüfungspunkt ist sowohl für den Anspruchsteller als auch den Anspruchgegner zu prüfen.
- Haftungsverteilung: Für die Haftungsverteilung sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere fahrzeugbezogene und fahrbezogene Umstände zu berücksichtigen, die Haftungsquote steigt etwa, wenn man zu schnell gefahren ist oder die Vorfahrt nicht beachtet hat. Auch das Fahren eines besonders schweren oder hochmotorisierten Fahrzeugs ist für die Quote relevant, sofern sich dieser Umstand auf den Unfall ausgewirkt hat.
- Mind. 80 / 20: Dazu sollte man berücksichtigen, dass es keine Haftungsquote gibt, die niedriger als 20 % liegt. Die Mithaftungsquote beträgt also entweder mindestens 20 % oder 0 %. Eine Haftungsquote von 100 % zu 0 % ist nur in Fällen von besonders schweren Verkehrsverstößen denkbar, in der Regel ist es angezeigt jedem Beteiligten aufgrund der Verwirklichung der Betriebsgefahr des Kfz zumindest einen gewissen Haftungsanteil zuzuweisen.